Über das Projekt
Das Projekt Austausch von Polizei und Zivilgesellschaft zu Antisemitismus – kurz APZAS – verfolgt zum einen die Initiierung und Begleitung des Austauschs zwischen regionalen RIAS-Meldestellen und Landeskriminalämtern. Zum anderen widmet sich das Projekt der empirischen Untersuchung der polizeilichen Erfassung antisemitischer Straftaten.
In der Arbeit von RIAS werden immer wieder Fälle bekannt, in denen Betroffene von Antisemitismus darauf verzichten, eine Anzeige zu stellen. Die Gründe dafür sind vielfältig, wie z.B. der Eindruck, eine Anzeige würde nichts bringen, aber auch ein geringes Vertrauen in die Arbeit der Polizei. Im Anbetracht eines erheblichen Dunkelfelds antisemitischer Straftaten zeigt die Erfahrung von RIAS, dass ein (Daten-)Austausch mit der Polizei das Lagebild verdichten kann. Die RIAS-Meldestellen werden daher bei der Initiierung und Begleitung von Kontakten zu den Polizeidienststellen vor Ort unterstützt, um einen kontinuierlichen fallbezogenen Austausch und einen systematischen, datenschutzkonformen Datenabgleich zu etablieren. Der Austausch ermöglicht die Prüfung von möglichen Dopplungen in den jeweiligen Statistiken und dient dem besseren Verständnis der erlangten Daten. Die Analyse der Erhebungsweisen antisemitischer Straftaten in der polizeilichen Statistik für politisch motivierte Kriminalität (KPMD-PMK) durch den Bundesverband RIAS haben Erkenntnisse kriminologischer Forschung bestätigt, dass die polizeilichen Statistiken zwar einer einheitlichen Erhebungslogik folgen, jedoch eine eingeschränkte Aussagekraft haben. Wie der Bericht des Unabhängigen Expertenkreis Antisemitismus (UEA) von 2017 zeigt, besteht eine erhebliche Wahrnehmungsdiskrepanz: Betroffene nehmen Antisemitismus als deutlich gravierender wahr als etwa die Polizei. Diese Diskrepanz resultiert auch aus Schwierigkeiten beim Erkennen des antisemitischen Tatmotivs und der statistischen Zuordnungspraxis. Der Bundesverband RIAS führte daher Interviews mit Polizei, Justiz, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu Fragen der bundesweiten Einheitlichkeit der polizeilichen Erfassung im Bundesgebiet, zu Herausforderungen der statistischen Zuordnungspraxis sowie zum zugrundeliegenden Antisemitismusverständnis. Darüber hinaus werden Daten antisemitischer Straftaten, die von LKÄ und BKA zur Verfügung gestellt wurden, ausgewertet.
Kontakt
| Bianca Loy (Projektleiterin) |
Publikationen
„Antisemitismus kommt gerne in der Verpackung daher ... und die macht es dann eben schwierig.“Antisemitische Straftaten in der Polizeistatistik. Ergebnisse des Projekts Austausch von Polizei und Zivilgesellschaft zu Antisemitismus (APZAS)
Antisemitische Straftaten in der Polizeistatistik
2025-11-25Bundesverband RIAS e.V.
Wie geeignet ist das Extremismusmodell des KPMD-PMK, um antisemitische Straftaten zu dokumentieren?Ergebnisse aus einem praxisorientierten Forschungsprojekt.
Erschienen in MOTRA-Monitor 2023/24, Kemmesies, Uwe et al. 2025, 506–519
2025Colin Kaggl, Bianca Loy
Leerstellen der Erfassung antisemitischer Straftaten durch die Polizei in Deutschland
Erschienen in: Sozialwissenschaftliche Rundschau, Nr. 4 (2024): 372–386
2024Colin Kaggl, Bianca Loy
Antisemitische Straftaten dokumentierenLeerstellen, Herausforderungen und Grenzen polizeilicher Statistiken
Erschienen in: Der Rechtsstaat im Kampf gegen Antisemitismus. Perspektiven auf Polizei, Justiz und Strafvollzug, Giesel, Linda und Borchert, Jens. Beltz Juventa 2024, 21–32
2024Colin Kaggl, Bianca Loy, Daniel Poensgen, Benjamin Steinitz
Förderung
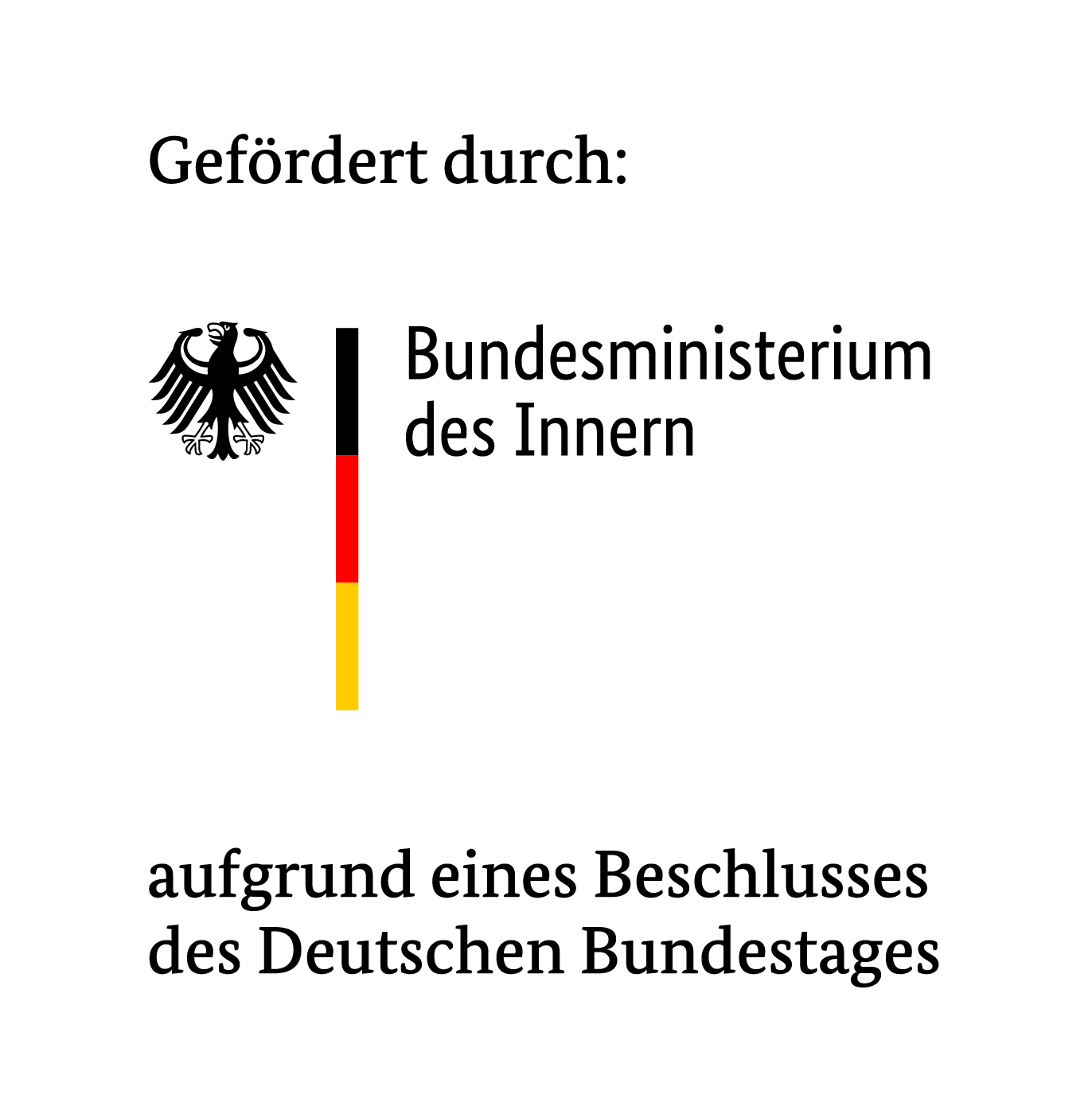
Vorträge
Antisemitismus und Polizei. Erfassung, Verständnis und Umgang mit BetroffenenErgebnisse eines zivilgesellschaftlichen und praxisorientierten Forschungsprojekts
Vortrag auf der Jahrestagung des Arbeitskreis Empirische Polizeiforschung in Dresden
12. September 2025Colin Kaggl, Bianca Loy (2025)
Through the Eyes of the Victims:Documenting the Gaps in the Recording and Prosecution of Antisemitic Crimes by the Police and Judiciary in Germany
Panelbeitrag auf der Contemporary Antisemitism 2025 Konferenz in London
2. April 2025Till Hendlmeier, Colin Kaggl
Police Statistics on Antisemitism in Germany.Results from a Civil Society and Practice-Oriented Research Project
Panelbeitrag auf der 16. Konferenz der European Sociological Association (ESA) in Porto
28. August 2024Colin Kaggl
Zivilgesellschaftliche und Betroffenenorientierte Perspektiven auf das Extremismusmodell des KPMD-PMK:Ergebnisse aus einem praxisorientierten Forschungsprojekt des Bundesverband RIAS e.V.
Panelbeitrag auf der MOTRA Konferenz #24 in Wiesbaden
8. März 2024Colin Kaggl, Bianca Loy